Diagnostik ist bei Lungenkrebs entscheidend
Warum die Expertise von vielen Fachgebieten das Beste für Patientinnen und Patienten herausholen kann und wie solche Kooperationen zu organisieren sind, erläutert Prof. Jürgen Wolf im Interview. Er ist Mitbegründer und Sprecher des nationalen Netzwerks Genomische Medizin Lungenkrebs in Köln. Die Lebenserwartung bei Lungenkrebs hat sich deutlich verbessert – erst recht dann, wenn man ihn genau charakterisieren kann.

Prof. Jürgen Wolf, Mitbegründer des nationalen Netzwerks Genomische Medizin Lungenkrebs (nNGM)
Lungenkrebs wird nach dem neuesten Stand des medizinischen Wissens mit personalisierter Medizin bekämpft. Was verrät die Molekularbiologie mehr über die Beschaffenheit des Tumors als das Mikroskop?
Das Mikroskop ist unverzichtbar für die korrekte Bestimmung des Tumortyps. Die personalisierte Medizin geht nach der Tumordiagnose einen entscheidenden Schritt weiter. Wir haben gelernt, dass Lungenkrebs nicht gleich Lungenkrebs ist, sondern dass man ihn in eine Vielzahl von Untergruppen einteilen kann, die alle durch spezifische Mutationen – also Änderungen im Erbgut – charakterisiert sind. Da diese Mutationen verantwortlich dafür sind, dass der Krebs wächst, spricht man auch von Treibermutationen. Für viele dieser Treibermutationen gibt es mittlerweile zielgerichtete Medikamente. Wenn man diese Mutationen also mittels molekularer Diagnostik entdeckt, hat man sozusagen die Achillesferse des Tumors erkannt und kann ihn sehr viel spezifischer und wirksamer behandeln.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Die erste therapeutisch relevante Treibermutation beim Lungenkrebs war die Mutation im sogenannten EGF-Rezeptor. Diese Mutation findet man bei uns etwa bei jedem zehnten Lungenkrebspatienten. Wenn man Patienten mit dieser Mutation jetzt mit spezifischen Medikamenten, sogenannten EGFR-Inhibitoren, behandelt, profitieren diese mit einem wesentlich höheren Ansprechen (ca. 70 Prozent deutliche Tumorschrumpfung) und einem um Jahre verlängerten mittleren Überleben bei guter Lebensqualität. Zum Vergleich: Noch vor wenigen Jahren stand für diese Patienten nur die Chemotherapie zur Verfügung mit einer Ansprechrate von ca. 25 Prozent und einem mittleren Überleben von nur einem Jahr. Bei der zielgerichteten Therapie, bei der der Patient nur Tabletten einnehmen muss, sind auch die Nebenwirkungen viel geringer. Die meisten Patienten können ihr ganz normales Leben weiterführen, Sport treiben und ihrem Beruf nachgehen.
Das nationale Netzwerk Genomische Medizin (nNGM) gilt als Vorreiter. Inwieweit ist die individualisierte Tumortherapie bei Lungenkrebs im Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung abgebildet? Oder entscheidet immer noch die Mitgliedschaft in der Krankenkasse über die Behandlungsform bei Lungenkrebs?
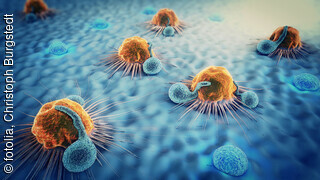 Lungenkrebs nicht gleich Lungenkrebs: Es gibt viele Untergruppen, die alle durch spezifische Mutationen charakterisiert sind.Das Hauptproblem ist nicht die Kostenerstattung. Von den für Lungenkrebs bekannten circa 15 therapeutisch angehbaren Treibermutationen gibt es für fünf mittlerweile zugelassene Therapien, die von den Krankenkassen erstattet werden. Allerdings werden noch immer circa ein Drittel der Patienten überhaupt nicht auf diese Mutationen getestet, so dass sie gar keine Chance auf eine personalisierte Behandlung erhalten. Das bedeutet einen Verlust von Tausenden Patientenlebensjahren jedes Jahr in Deutschland, denn Lungenkrebs ist noch immer die häufigste Krebstodesursache.
Lungenkrebs nicht gleich Lungenkrebs: Es gibt viele Untergruppen, die alle durch spezifische Mutationen charakterisiert sind.Das Hauptproblem ist nicht die Kostenerstattung. Von den für Lungenkrebs bekannten circa 15 therapeutisch angehbaren Treibermutationen gibt es für fünf mittlerweile zugelassene Therapien, die von den Krankenkassen erstattet werden. Allerdings werden noch immer circa ein Drittel der Patienten überhaupt nicht auf diese Mutationen getestet, so dass sie gar keine Chance auf eine personalisierte Behandlung erhalten. Das bedeutet einen Verlust von Tausenden Patientenlebensjahren jedes Jahr in Deutschland, denn Lungenkrebs ist noch immer die häufigste Krebstodesursache.
Zusätzlich können weitere Patienten mit Mutationen, für die es noch keine zugelassenen Medikamente gibt, profitieren, indem sie nach einer erweiterten molekularen Diagnostik in klinischen Studien behandelt werden. Auch diese Möglichkeit wird leider für einen großen Teil der Patienten nicht genutzt. Genau hier setzt das nNGM an. Hier wird eine breite, qualitätsgesicherte molekulare Diagnostik auf alle bekannten Treibermutationen, verbunden mit einer Therapieempfehlung inklusive Studienempfehlung, von zur Zeit 17 spezialisierten forschungsnahen Zentren für alle Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs angeboten. Die Behandlung selbst kann dann heimatnah in kleineren Krankenhäusern und onkologischen Praxen erfolgen.
Wie kann eine flächendeckende Versorgung auf diesem hohen Niveau erreicht werden?
Das ist die zentrale Herausforderung, der wir uns mit unserem Netzwerkansatz stellen. Wir praktizieren eine intelligente Arbeitsteilung zwischen hochspezialisierten Zentren und Medizinern in der Breite der Versorgung. Die immer komplexer werdende molekulare Diagnostik und Therapieempfehlung erfordern Spezialistenwissen, das nur forschungsnahe Spitzenzentren vorhalten, wo Molekularpathologen, Kliniker mit Erfahrung in personalisierten Therapien und Grundlagenforscher zusammenarbeiten. Nur ein enger, interdisziplinärer Austausch schafft das Wissen, um für den Patienten das Optimale herauszuholen.
Wir haben zunächst für Köln und Umgebung gezeigt, dass es funktioniert. Das Tumorgewebe von jedem Patienten wird an ein spezialisiertes Zentrum überwiesen, dort läuft die Gensequenzierung, die Beschreibung der Treibermutationen und eine Empfehlung zur Therapie. Der Patient selbst kann, sollte er nicht gerade in eine Studie eingeschlossen sein, heimatnah behandelt werden. Allein im Kölner Bezirk arbeiten wir mit rund 300 Partnern – niedergelassene Ärzte sowie Krankenhäuser – zusammen und haben bei 5.000 Patienten im Jahr den Tumor mittels Gensequenzierungsmethoden analysiert. Im nNGM weiten wir dieses Modell seit zwei Jahren erfolgreich auf ganz Deutschland aus und erfassen jetzt bereits jährlich rund 14.000 von in Frage kommenden 30.000 Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs.
Wie läuft die Kooperation mit anderen Zentren?
In allen rund 20 nNGM Zentren gibt es jetzt eine einheitliche Diagnostik und Interpretation, harmonisierte Empfehlungen und eine gemeinsame Evaluation. Wir versuchen auch, bei den Studien zusammenzuarbeiten und haben eine einheitliche Qualitätssicherung für die NGS Diagnostik eingeführt, die es so bisher nicht gab.
Welche Rolle spielen Komorbiditäten bei Lungenkrebspatienten?
Eine ganz große. Früher bei der Chemotherapie noch mehr. Die Mehrheit der Patienten sind Raucher und haben oft Begleiterkrankungen wie zum Beispiel eine koronare Herzkrankheit oder eine chronisch obstruktive Bronchitis. Diese Patienten vertragen Chemotherapie und auch andere Therapien oft schlecht. Hier kommt der Vorteil der neuen Therapien noch mehr zum Tragen.
Stichwort partizipative Entscheidungsfindung: Was kann der Patient mitentscheiden?
Patienten sind sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, die sind sehr gut informiert. Es existieren bereits Mutations-spezifische Selbsthilfegruppen, die sich über internationale Studienergebnisse austauschen wie zum Beispiel Lungenkrebspatienten mit einer ROS1-Translokation. Generell kommen mehr Patienten mit Vorwissen. Eine typische Situation für eine gemeinsame Entscheidungsfindung ist beispielsweise, ob ein Patient ein zielgerichtetes Medikament auf Verschreibung erhält oder in eine Studie eingeschlossen wird. Die Studie bedeutet in der Regel eine nicht unerhebliche zeitliche Belastung, bietet aber oft den Vorteil der Verfügbarkeit eines neuen, vielleicht besseren Medikaments.
Was ändert sich für Sie im klinischen Alltag in Pandemie-Zeiten?
In der ersten Welle konnten wir alle Patienten wie gewohnt versorgen. Es gab aber viele Anrufe von Patienten, die extern keine Termine mehr bekamen und in großer Not waren. Wir haben darüber hinaus schnell auf Videosprechstunden umgestellt, was uns jetzt in der zweiten Welle zugute kommt. Kontrolltermine finden zunehmend über Videosprechstunden statt, Blutkontrollen durch den Hausarzt. Die Zweitmeinungssprechstunde läuft aktuell nur noch über Video. Aber alle Patienten, die eine Behandlung benötigen, erhalten diese auch weiterhin. Wir hoffen, dass es so bleibt.
Hier geht‘s zum Netzwerk genomische Medizin Lungenkrebs in Köln.
Zum Weiterlesen
„Jeder Tumor braucht seine eigene Diagnostik“
„Wir brauchen doppelt so viele Krebsberatungsstellen“
